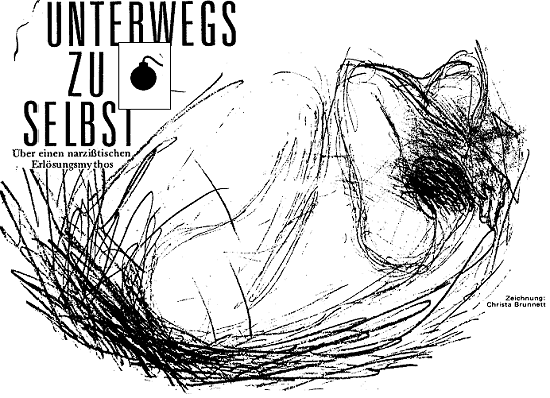"Heute schon gelebt?" fragt
lakonisch ein Graffiti der Szene. Als bedürfe das Leben schon einer
Wiederbelebung durch solch provokative Erinnerung. Es scheint problematisch
geworden, sich als lebendiges Wesen zu empfinden. In einer Zeit, aus der der
Sinn verschwunden, in der Berufe, wenn überhaupt zu haben, zu Jobs verkommen
und der Andere fremd geworden ist, sucht man quasi im Kampf um die allerletzte
Bastion sich auf das zu beziehen, was scheinbar selbstverständlich übrig
bleibt: die eigene Innenwelt als gleichsam einzig gewisser Ort in einer
zerfallenen Welt. Da wird das Eigene wiederentdeckt oder neu erfunden, geliebt,
in Watte gepackt oder herausgebrüllt, werden in dessen Hinterwelten Werte
entdeckt, die für den Verlust der einen, großen Welt entschädigen sollen.
Deshalb
gilt es dann -
ob durch Astrologie oder
Therapie, durch Meditation oder Massage - ,,mit sich eine Erfahrung zu
machen" ,,in sich zu gehen, um aus sich herauszukommen , ,,sich auf die
Reise zu sich selbst zu machen" etc. Die eigentümliche Leere solcher Sätze
zeigt sich auch sprachlich an lauter Reflexivpronomina: ich" werde
,,mir" selbst zum Gesprächspartner. Letzter Ort -
autistischer Ort? Intendiert ist durchaus
etwas anderes: die eigene Innenwelt wird zum gleichsam archimedischen Punkt,
von dem her -
gelänge doch erst ihre
Entrümpelung -
Beziehungen wieder
lebbar, Welt wieder sinnvoll werden könnte. Bloch war allerdings anderer
Meinung: "Alles Innen ist an sich dunkel. Um sich zu sehen und gar, was um
es ist, muß es aus sich hinaus. Man muß sich herausmachen, damit es überhaupt
erst etwas sehen kann."
Das heile Selbst
In
geradezu inflationärer Weise taucht in allen Versuchen der Introspektion der
Begriff des Selbst auf. Ob ausdrücklich thematisiert oder nicht, überall steht
das Selbst im Raum, als Selbsterfahrung, Selbstfindung, Selbstbegegnung, Weg
zum Selbst.
Das
Selbst scheint die Erlösung. Immer gilt das Selbst gegen den Verzicht auf
positive Werte in der traditionellen Psychoanalyse - als Unverstelltes hinter
allen Masken, die innerste Harmonie, der man trotz (oder wegen?) aller
schmerzlichen Erfahrung selbst-besessen nachjagt. Es ist der vor allem Außen
liegende ureigenste Wert, den es neu zu entdecken gilt: Heiles hinter allen
Wunden. Gegen die Zerrissenheit der Welt sucht das Selbst in sich deren
Versöhnung: Einheit von Fühlen und Denken, Kopf und Bauch, Männlichem und
Weiblichem, Anschluß ans kosmische Universum.
Sein
Anspruch ist nicht gerade bescheiden. Entgegen Foucaults These, daß die Machtverhältnisse
das Körperinnere durchziehen, steht das Selbst für den zu findenden, in sich
abgeschlossenen ruhenden Punkt v o r der Welt, von deren Beschädigungen es
nicht durch zogen ist. So gibt es denn doch etwas Wahres im Falschen. Während
bei Freud das Ich nicht Herr im eigenen Haus ist, sondern sich zwischen den
Mühlsteinen des Unbewußten (er)findet, präsentiert sich das Selbst als Erstes
und als souverän. Deshalb formulierte Lacan die Freudsche Einsicht in der
provokanten These ,"Ich ist ein Anderer", während für F. Perls
Gestalttherapie die Welt wieder in Ordnung ist: "Ich bin, was ich
bin". Dennoch wird dem, was traditionellerweise Ich genannt wurde,
mißtraut, weil es trotz aller neurotischen Deformationen, trotz
Mama-Papa-Ödipus zu stabil scheint, falsche Identitäten vorzugaukeIn, einfach
zu wenig ,"selbst" ist.
Und in
der Tat scheint dem Ich der Bezug zur Welt nicht in der heutigen fundamentalen
Weise fraglich, es bezeichnet das, was bis in die politische Linke hinein für
kulturell wertvoll galt: Bedürfnisaufschub und Sublimierung, Arbeitsethos und
Realitätsorientierung, Vernünftigkeit. Dies hingegen ist auf der Suche nach dem
Selbst in Verruf gekommen, Sublimierung etc. gilt als fauler Trick der
Ablenkung von sich, vor der Realitätsbewältigung rangiert die Selbsterfahrung,
da diese jene überhaupt erst möglich (vielleicht aber auch überflüssig) werden
läßt.
Die Verkehrung der Depression
Dem
Bedürfnis nach dem Selbst entspricht die Erfahrung der eigenen Inkohärenz, der
wiederum entspricht die Erfahrung gesellschaftlicher Sinnlosigkeit.
Ich
verliere meine Konturen, zerfließe in die gigantische Leere der Zeit. Ich
verbringe meine Tage regungslos oder stürze mich in hektische Betriebsamkeit.
Das ganze Leben ist ein träges Bett, das ich nicht verlasse. Dort liege ich im
fahlen Dämmer des Zwielichts und vergesse schließlich die Morgenröte. Ich weiß
buchstäblich nicht, wer ich bin, noch, was ich soll. Derart kreise ich um meine
verschwimmende Gestalt, versuche mich zu erreichen, um wenigstens etwas noch zu
fühlen.
So ist im
selben Maße, wie jedes Außen zerfallen ist, auch das Innen fraglich geworden.
Elementarstes scheint nicht mehr zu gelingen und wird im Namen der
Selbstfindung bedeutungsüberfrachtet wiederentdeckt. Der Atem wird ein zu
enträtselndes Ritual, dem ich in seiner geheimen Musik bis in die Spitzen
meiner Lungen folge, die Stimme setzt blockierte Energien wieder frei, im Gehen
versuche ich meditierend, den Kreis des Yin und Yang zu schließen. Ich
versuche, den Hunger nach Leben an meinem Körper zu stillen, er wird zur
Kultstätte meiner verlorenen Hoffnung. Im Namen des eigenen Wertes wird
Banalstes zur schöpferischen Qualität, der Alltag wird mangels anderer
Realitäten mystifiziert, im Namen der Kreativität wird gekocht und getöpfert,
gestrickt und genäht.
Und weiß
ich keine Zukunft mehr, befrage ich das Orakel, die Karten oder versuche, die
Sterne zu deuten, um im Chaos meiner Existenz eine letzte Ordnung zu finden,
die mir die Abgründe meines Unbewußten zu entschlüsseln vermag. Eigentlich
Folge einer Depressivität, wird die Suche nachdem Selbst zum Versuch einer
Selbst-Heilung, die ihre eigenen Gründe verkennt. Die Erfahrung von Sinn-, Ort-
und Zukunftslosigkeit wird affirmativ umgekehrt: Die unterstellte eigene
Ganzheit verheißt ein Glück in der (Selbst-) Gegenwart, das von der bangen
Frage nach dem, was war und was wird, entlasten soll. Diese Hinwendung zum
emphatischen Ich-Hier-Jetzt will gierig und verzweifelt zugleich all das Glück
zusammenraffen, das mitsamt der Zukunft schon verloren scheint.
Kopfloses Selbstverständnis
Alle Wege
führen zum Selbst über den eigenen Körper, er ist - in Abwandlung von Freuds
Wort - der ,Königsweg' zum Selbst. Damit ist für das Selbst das traditionelle
Verhältnis von Geist und Körper genau umgekehrt. Das Selbst präsentiert die
Kehrseite jener platonisch-ehristlichen Abwertung des Körpers, die auch in der
Neuzeit andauerte. Descartes, auf der Suche nach Gewißheit, streift den Körper
ab wie ein Korsett - mit dem vernichtenden Urteil: "diese ganze Gliedermaschine,
die man auch an einem Leichnam wahrnimmt". Für die Tradition verbindet
sich das Körperliche gerade mit der Angst, seine Identität zu verlieren: der
Körper ist assoziiert mit Begrenzung und Tod, ist abhängig von den Sinnen,
deren Wechselbädern ausgesetzt und der Herrschaft des Zufalls unterworfen.
Das
autonome Subjekt hatte keinen Körper. Aber in seiner langen Verbannung hat sich
der Körper mit utopischem Potential aufgeladen. Davon zehrt die Moderne.
Nietzsche wies ihr im Zarathustra die Perspektive: "Hinter deinen Gedanken
und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser
- der heißt Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er."
Nietzsches
polemisch-kritische Wendung wird der heutigen Bewegung zum Prinzip. Der Körper
avanciert im Selbst zur letzten Gewißheit und zur einzigen verläßlichen
Wahrheit. Das Ich verläßt den Kopf und rutscht in den Bauch: das Selbst ist ein
Körper-Ich.
Im
exakten Gegensatz zu Descartes ist nun der Kopf äußerlich geworden -
buchstäblich zu einem Fremdkörper, der den unmittelbaren Kreislauf meiner
Selbstvergewisserung unterbricht, wenn er mit seinen Begriffen abstrahiert, von
mir ,abzieht' und zu verallgemeinern beginnt. Wegen dieser Tendenz ins Allgemeine
ist dem Selbst alles Theoretische schon grundsätzlich ein Akt der Entfremdung,
Denken wird geradezu abwegig.
Nur der Körper (er)zählt
Gleichfalls
mißtraut das Selbst der Sprache. Es spürt ihre zunehmende Verödung, bei der die
Sensibilität der Sprache schwindet und ihre Ausdruckskraft versiegt: Niemand
sagt etwas, MAN spricht. Die Sprache verkommt zum Markt der Zeichen; hier
bedienen sich die Politiker und schmücken sich mit frischen Etiketten; hier
machen die (neuen) Medien ihre Profite und schaffen Bedeutungen, denen nichts
entspricht; hier tönt die Sprache laut und hohl, steril und lackiert wie die
Reklame, von der sie immer mehr durchdrungen wird.
Das
Selbst leidet an dieser Sprache. Es zieht sich aus dieser empfindungslosen
Fremde zurück - in seinen Körper und gibt ihm, der geknebelt und mundtot
gemacht war, gleichsam das gestohlene Wort zurück. Pantomime, Ausdruckstanz und
Bewegungstheater finden jetzt im Körper eine Grammatik der Nähe. Die
Bioenergetik zeigt, wie der freifließende vitale Rhythmus der Stimme die kalten
Wörter erwärmt. Überhaupt entthronen Mimik und Gestik in ihrer konkreten
Bildhaftigkeit die abstrakte Bezeichnung der Wortsprache. Die wiedergefundene
Körpersprache scheint unmittelbarer, authentischer und emotionaler als die
verbale. Mehr noch:
für F.
Perls ist der Inhalt einer Rede nicht mehr von Belang: "Ihr braucht nicht
auf das zu hören, w a s dieser Mensch sagt: hört auf den Klang. Der Klang sagt
euch alles. Alles, was ein Mensch ausdrücken will, ist da - nicht in den Worten."
In der
Körpersprache betreibt das Selbst sein doppeltes Spiel. Im Exhibitionismus seiner
theatralischen Gesten lebt es seine uneingestandene Beziehungssuche aus,
während es gleichzeitig narzißtisch und selbstbezogen bleibt - denn die Gebärde
verläßt den Körper gleichsam nur halb, gerade soweit, um sichtbar zu sein, um
den anderen massiv zu beeindrucken, ohne sich aber gänzlich von mir abzulösen.
Die Gebärde bleibt bei mir und nährt den Traum einer Privatsprache, einer besonderen
reichen inneren Ausdruckswelt, die unverlierbar mein eigen ist.
In
Wahrheit ist die Gebärdensprache, mag sie auch archaischer sein, keineswegs
natürlich, vielmehr kulturell bestimmt. Aber wichtiger noch: Was die
Körpersprache an Emotionalität voraushat gegenüber dem Wort, das büßt sie an
Eindeutigkeit und Komplexität zugleich ein. Weil es ihr an Gehalt und Differenzierungsvermögen
mangelt, ist sie genau auf die kalte Computersprache angewiesen, von der sie erlösen
möchte.
Glauben aus zweiter Hand
Die
westliche Zivilisation hat vor ihrem Wissen Angst bekommen. Das Wissen
erscheint wie ein tödliches Prinzip -in Gestalt immer perfekterer Waffen, in
jenem Wachtumsmoloch, der in die ökologische Katastrophe hineinwuchert,
schließlich in der Figur des Computer! Roboter, der den Menschen überflüssig
macht.
Es ist
als ob die Hoffnung keinen rationalen Boden mehr fände, grundlos wäre, als ob
die Hoffnung nur im Irrationalen weiterleben könnte. Die Bewegung zum Selbst
zieht diese Konsequenz und stürzt sich in alle verfügbaren Irationalismen. Im
Glauben will sie einen Lebenssinn zurückerhalten, den die Vernunft nicht mehr
gewährleistet.
Das
Selbst stattet den Körper, dem es vertraut, mit okkultem Tiefsinn aus. Gläubig
vertieft es sich in die Linien seiner Hände, erfährt, daß dort sein
persönliches Schicksal eingraviert sei. So erhält es von der Esoterik eine
wunderbare Unverwechselbarkeit zurück, die wir in der Realität längst nicht
mehr haben.
Und über
dem verrätselten Mikrokosmos seines Körpers wölbt sich nochmals ein schirmender
Makrokosmos: das Firmament der Astrologie. Die Sterne bilden eine Konstellation,
in der die Identität das Selbst geheimnisvoll festgehalten, im großen nochmals
bestätigt wird. Wo die Vernunft alle Mythen versagt, bietet der Himmel
astrologischen Zuspruch, garantiert das All eine kosmische Ordnung, die der
Welt abhanden gekommen ist.
Aber das
Bedürfnis zu glauben ist nicht naiv, vielmehr ein unsicheres Glauben-wollen,
das der nihilistischen Krise entspricht. Hungrig nach Spirituellem pilgert es
gen Osten, um sich an orientalischen Lehren zu sättigen. Dabei überzieht es die
fernöstliche Weisheit mit Bildern eigener tiefer Sehnsüchte. In der mystischen
Versenkung von Yoga und Zen-Meditationen sieht es jenen Weg nach Innen, der zum
Einklang von Mensch und Natur (zurück)führt. Das Selbst findet hier einen kontemplativen
Gegenentwurf zur europäischen Betriebsamkeit: anders als in der westlichen vita
activa ist Natur etwas, das man nicht permanent bewältigen, überwinden, verändern
muß; hier gibt es auch ein passives Gelingen, ein Glück, das die Dinge belassen
kann. Der Meditierende darf in die Natur eintauchen, weil darin selber
Übersinnliches ruht - wie jene Altäre in altindischen Tempeln, die 2-3 m tief
in die Erde versenkt sind.
Aber
dieser Naturbegriff läßt sich nicht in unsere Kultur importieren, genausowenig
das fernöstliche Empfinden. C.G. Jung plädiert, "sich entschlossen zur
geistlichen Armut der Symbollosigkeit zu bekennen", anstatt "in
orientalische Paläste einzudringen".
Das
Selbst jedoch will die kulturellen Schwellen überspringen. Mit gieriger Direktheit
führt es die fremden Lehren und Mythen seinem Hunger nach Selbstfindung zu: Sie
werden alle rigoros durchpsychologisiert und darin für die kleinen privaten
Belange zurechtgestutzt. So wird das I Ging, das die ganze Naturphilosophie,
Soziallehre und Ethik einer altchinesischen Welt enthält, auf die Funktion
eines Heimorakels reduziert. Am Ende praktiziert die Selbst-suche genau jenen
Konsumismus, vor dem sie im Osten Rettung erheischte.
Die narzißtische Drehung
So
verlängert sich das, wogegen man antritt, in seinen umgekehrten Vorzeichen; der
alten Kopf- folgt eine neue Körperlastigkeit, übersah man früher die Gebärde,
wird nun der Redeinhalt marginal, schließlich trifft die alte Diskreditierung
von Gefühl und Intuition jetzt umgekehrt Argument und Logik.
Und
analog solcher Verkehrung läßt sich auch die Konzeption des Selbst als die progressive
Seite des traditionellen Ichs beschreiben. Dessen traditionellem Weltbezug
setzt es einen grandiosen Selbstbezug entgegen. Bezeichnend für solche
Verkehrung scheint auch die umgestülpte Bedeutung von Begriffen wie Arbeit oder
Handeln. Sie meinen nicht länger ein Verhältnis zur äußeren Realität - sei es
Natur oder Gesellschaft - sondern Arbeit wird zu Körperarbeit, zur Arbeit an
der Regression, Handeln wird verkürzt zur bloßen (Körper-)Bewegung.
Derart
mit der Enträtselung der Geheimnisse seines Körpers und seines darin aufscheinenden
Unbewußten befaßt, kann das Selbst bei sich bleiben und schließt sich gleichsam
ab. Denn die Konzeption des Selbst folgt dem Trachten des Narziß: es will in
seiner Selbst-berührung aufgehen und duldet die Welt nur als Spiegel. Wie
Narziß lauscht das Selbst fasziniert seinem eigenen Atem, hört seiner eigenen
Stimme zu, wie er feiert es den Tanz seiner Gebärden und forscht nach seiner Wirkung
in den Augen anderer.
In seinem
regressiven Begehren nach Selbst-Ausdruck verlängert sich, durchaus gegen
seinen Anspruch, die Unterscheidung von Innen und Außen, die zugleich Grund
seines Leidens ist. Denn die Erhöhung des Selbst zum quasi transzendentalen'
Ort, von dem her Welt und Beziehungen wieder ins Lot gebracht werden sollen,
setzt in paradoxer Weise gerade die Abtrennung des anderen fort, wie es zur
Nabelschau der Szene paßt. Affirmativ setzt es seine eigene Wahrheit, das unmittelbare
Recht seiner Bedürfnisse; kopflos und bauchlastig frönt es der Beliebigkeit seiner
Lüste, indem es sich ,holt, was es braucht' und stehenläßt, was zu anstrengend.
Deshalb bleibt der andere in seinem Leiden strukturell fremd, statt einer
wirklichen Beziehung findet nur eine Spiegelung statt.
Kompensatorisch
gegen solche Erfahrung steht das Bedürfnis nach Auflösung der Vereinzelung in
einem amorphen Gruppenkosmos, wie er gerade im ritualisierten Zeremoniell von
Workshops, Körperwochenenden etc. beschworen wird. Wir geben uns alle die
Hände, bilden einen Kreis und sehen uns tief in die Augen. Die schweiß-feuchte
Hand links ist mir zuwider, und mein Gegenüber, die den Platz neben ihrer
Freundin ergattert, kann mich nicht leiden. Aber in der Sicherheit individueller
Verantwortungslosigkeit wird (dem Anspruch nach) geliebt, sich fallengelassen
und aufgefangen, werden großherzig Energien verteilt bis hin zum gigantisch verzweifelten
Gruppenorgasmus, so im Film "Abenteuer meiner Seele". Doch die Sehnsucht
nach Verschmelzung ist bekanntlich nur eine Variante des Narzißmus.
Das Selbst
dreht sich im Tanz seiner Eitelkeit. Scheinbar ganz bei sich, sucht es
verstohlen den Blick des anderen, um sich mit ihm zu schmücken. Gierig saugt es
seine Wirkung auf, um in den souveräner werdenden Pirouetten seiner Bewegungen
das Begehren zu forcieren. Es hält sich den anderen als Spiegel vor, indem es
dessen Begehren begehrt. So bleibt es allein auf dem Tanzboden der verlorenen
Hoffnung.
Inge Breuer / Peter Leusch